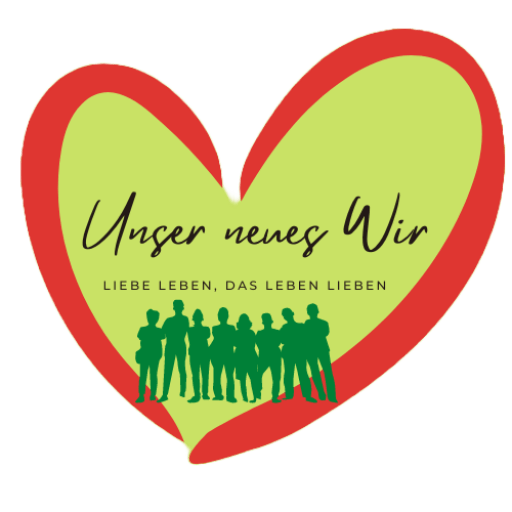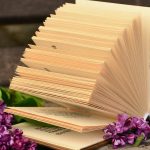Die kindliche Seele und ihr natürlicher Beginn
Ein neues Leben betritt die Welt – ein Moment puren Glücks für die Eltern und der Beginn einer Reise voller Vertrauen und Geborgenheit für das Kind. In den ersten Jahren ist die Welt in Ordnung, so wie sie ist. Das Kind braucht nicht viel: Nähe, Schlaf, Entdeckungsfreude. Es begreift die Welt buchstäblich mit den Händen und dem Mund. Alles wird ertastet, erfühlt, erschmeckt. Die Eltern sind in dieser Phase die wichtigsten Vorbilder. Sie vermitteln, was wertvoll ist, was gefährlich sein könnte und was gut tut. Diese frühen Prägungen tragen oft die Handschrift dessen, was die Eltern selbst einst von ihrer eigenen Familie gelernt haben.
Die natürliche Harmonie und erste Interessen
Kinder begegnen anderen Menschen zunächst ohne Vorurteile. Sie kennen keine Missgunst, keinen Neid, kein Misstrauen. Studien belegen, dass Kleinkinder von Natur aus dazu neigen, Spielzeug und Essen zu teilen. Sie leben in einer Art Eintracht, die vielen Erwachsenen fremd geworden ist. Mit der Zeit zeigen sich frühe Vorlieben und Talente. Das Kind vertieft sich in Dinge, die es fesseln, bei denen die Zeit keine Rolle spielt. Diese unbeschwerte Hingabe ist ein kostbares Gut.

Der Einschnitt: Wenn die Schule beginnt
Doch diese Leichtigkeit erfährt oft einen jähen Bruch, wenn die Schulzeit beginnt. Plötzlich muss das Kind in einem geregelten System funktionieren. Es wird mit Konzepten wie Uhrzeit und Bewertung konfrontiert – Konstrukte, die in der natürlichen Ordnung von Tag und Nacht nicht existieren. Viele Kinder reagieren verunsichert auf diesen abrupten Wechsel. Der oft zitierte „Ernst des Lebens“ beginnt, eine Formulierung, die bereits erahnen lässt, dass hier etwas Erzwungenes, Schweres beginnt.
Der Druck des Systems und seine Folgen
In der Schule wird das Kind Teil eines Wettbewerbs. Es wird benotet, verglichen und bewertet. Ein Erwachsener, die Lehrperson, bestimmt, was richtig oder falsch ist. Dabei geht es häufig weniger um das individuelle Lernen als um die Anpassung an Normen. Nicht jedes Kind lernt auf die gleiche Art und Weise, doch das System lässt oft wenig Raum für Unterschiede. Wenn ein Kind den Stoff nicht versteht oder uninteressiert wirkt, wird dies häufig als Defizit gewertet, nicht als Hinweis auf einen anderen Lernweg.
Die Folgen sind vielfältig: Angst, Unsicherheit und ein schwindendes Selbstvertrauen. Wenn dann auch noch zu Hause der Leistungsdruck weitergeht, weil Eltern vor einer vermeintlich düsteren Zukunft ohne gute Noten warnen, zieht sich das Kind häufig noch mehr in sich zurück. Es beginnt, an sich selbst zu zweifeln. Im schlimmsten Fall wird es zum Außenseiter, weil es sich den Erwartungen nicht beugen kann oder will. Die schulischen Leistungen leiden, die Enttäuschung der Eltern wächst – ein Teufelskreis beginnt.
Die Verantwortung der Eltern: Hinsehen und handeln
An dieser Stelle sind die Eltern gefordert. Es gilt, genau hinzusehen: Ein unruhiges oder lautes Kind ist nicht notwendigerweise „schwierig“ – es signalisiert oft nur, dass es unterfordert, gelangweilt oder unverstanden ist. Ein besonders stilles Kind, das nicht mehr über die Schule sprechen mag, trägt möglicherweise bereits eine Last mit sich herum, die es innerlich auffrisst.
Eltern sollten mutig genug sein, die Stärken ihrer Kinder zu erkennen und zu fördern – auch wenn sie nicht den schulischen Erwartungen entsprechen. Nicht jedes Talent zeigt sich in Noten. Manchmal braucht es den Blick für das, was jenseits des Lehrplans liegt. Wenn das Schulsystem dem Kind schadet, ist es keine Schande, nach Alternativen zu suchen oder Hilfe von außen hinzuzuziehen.
Jeder Mensch trägt einzigartige Potenziale in sich. Es liegt an uns, sie nicht verkümmern zu lassen.