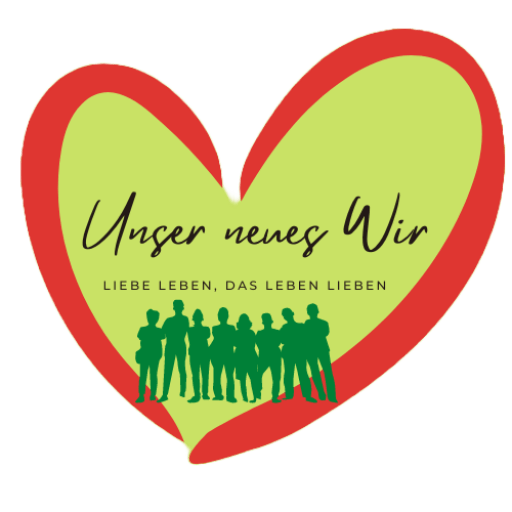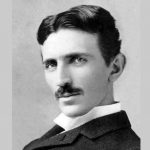Vom Produktionsort zum Wohnraum: Spaniens industrielles Architekturerbe im Wandel
Städtebauliche Entwicklungen führen seit Jahrzehnten dazu, dass produzierende Betriebe ihre Standorte in urbanen Zentren aufgeben. Auslöser sind häufig verschärfte Umweltauflagen, Konflikte aufgrund von Lärmemissionen oder die steigenden Immobilienpreise in innenstädtischen Lagen. Diese Verlagerung hinterlässt eine Vielzahl brachliegender Industriegebäude, die zunächst ihrer ursprünglichen Bestimmung beraubt sind. Doch genau diese Bauten wecken zunehmend das Interesse von Immobilienentwicklern und Architekten. Die charakteristischen Merkmale alter Fabriken und Lagerhallen – großzügige Grundrisse, hohe Deckenhöhen und eine üppige natürliche Belichtung – bieten ein außergewöhnliches Potenzial für eine Umnutzung. Dieser Trend zur Residenzialisierung, also der Umwandlung in Wohnraum, hat sich zu einer bedeutenden Strömung in der zeitgenössischen Architektur Spaniens entwickelt.
Internationale Vorbilder für den strukturellen Wandel
Die Transformation industrieller Bauten zu Wohnzwecken ist ein globales Phänomen. Ein historisch bedeutsames Beispiel findet sich in New York City. Die wirtschaftliche Krise der 1970er Jahre führte dort zur Schließung zahlreicher Fabriken und Lagerhäuser, unter anderem im Viertel SoHo. Die entstandenen Leerstände wurden bald als günstige Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten entdeckt, insbesondere von Künstlern und Kunsthandwerkern, die die weitläufigen Flächen für ihre Tätigkeiten benötigten. Eine der ikonischsten Figuren dieser Bewegung war der Künstler Andy Warhol, der eine stillgelegte Hutfabrik bezog und sie unter dem passenden Namen „The Factory“ zu seinem Atelier und einem kreativen Zentrum umfunktionierte.
Spanische Fallbeispiele für gelungene Transformationen
In Spanien lässt sich diese Entwicklung anhand zahlreicher Projekte nachvollziehen, die das architektonische Erbe des Landes bewahren und ihm durch innovative Konzepte neues Leben einhauchen.
Ein frühes und wegweisendes Projekt ist die Umgestaltung einer stillgelegten Zementfabrik in San Justo Desvern durch den Architekten Ricardo Bofill. Das Industrieareal aus dem frühen 20. Jahrhundert, bestehend aus mehr als 30 Silos, unterirdischen Gängen und großen Maschinenhallen, wurde ab 1973 zum Hauptsitz seines Architekturbüros Taller de Arquitectura sowie zu seinem privaten Wohnsitz umgebaut. Dieses Projekt demonstriert eindrücklich, wie ein bestehender Raum mit visionärer Kraft einer völlig neuen Nutzung zugeführt werden kann.
Ein Beispiel für die behutsame Erweiterung eines Industriedenkmals ist die Wohnraumrenovierung in Sabadell durch Cruz y Ortiz Arquitectos. Bei diesem Vorhaben aus dem Jahr 2007 wurde eine kleine, denkmalgeschützte Industrieanlage aus den Jahren 1900 bis 1903 restauriert und durch einen zusätzlichen Wohnaufbau ergänzt. Die Architekten legten Wert darauf, den Charakter des historischen Gebäudes zu wahren und diesen in den neu hinzugefügten Bauteilen fortzuschreiben, um so eine harmonische Einheit aus Alt und Neu zu schaffen.
Die Umwandlung einer ehemaligen Fabrik in ein Einfamilienhaus in Tárrega durch Guim Costa Calsamiglia zeigt einen puristischen Ansatz. Der Fokus lag hier auf der essenziellen Qualität des Bestandsgebäudes: dem großvolumigen Raum. Das Gebäude wurde in seiner äußeren Hülle und Kubatur nicht verändert. Die Intervention konzentrierte sich auf die Instandsetzung der Struktur und des Daches, wobei der weitläufige, lichte Innenraum mit einer Höhe von bis zu neun Metern als zentrales Gestaltungselement erhalten blieb.
In Barcelona steht die Transformation der ehemaligen Textilfabrik Grober durch Meta-studio exemplarisch für den Wunsch, den offenen und durchlässigen Charakter industrieller Räume mit den Ansprüchen an ein behagliches Zuhause zu vereinbaren. Das architektonische Konzept zielte darauf ab, den historischen, diaphanen Raumeindruck zu bewahren, gleichzeitig aber intimere und wohnlichere Bereiche innerhalb der großen Halle zu schaffen.
Ein weiteres Projekt in Barcelona, die Hausrestaurierung in Gràcia von Sergi Pons, befasste sich mit der Herausforderung, einen ehemaligen Lagerbau aus den 1960er Jahren in eine warme und einladende Wohnung zu verwandeln. Dabei wurde der industrielle Charakter bewusst betont, etwa durch die Verwendung von Stahlträgern, die in die Peripheriemauern eingelassen wurden, um die neuen Einbauten zu tragen.
Das Projekt Pilarica in Madrid, entwickelt von Taller de Casquería, verfolgt einen strategischen Ansatz zum Erhalt des industriellen Bauerbes. Es versteht sich als Teil einer Serie von Maßnahmen, die durch neuartige Nutzungs- und Belegungskonzepte die Lebensdauer solcher Gebäude verlängern und so ihrem Abriss entgegenwirken wollen.
Ein Projekt von großer städtebaulicher Bedeutung ist die Schaffung von 46 Wohneinheiten in der ehemaligen Fabra & Coats Fabrik in Barcelona durch Roldán + Berengué. Die Umwandlung dieses Textilkomplexes aus dem 19. und 20. Jahrhunderts ist Teil eines umfassenden Programms zur Etablierung von Kreativzentren. Bemerkenswert ist hier die Integration von Sozialwohnungen in ein denkmalgeschütztes Industriegebäude, was in dieser Form neu ist.
Die Anpassung einer ehemaligen Schokoladenfabrik in La Bisbal del Ampurdán durch Anna & Eugeni Bach zeigt die Vielfalt der umwandelbaren Bauten. Die Architekten passten die ungewöhnliche Typologie des kleinen Werks an die Bedürfnisse eines Familienwohnsitzes und Ateliers an, wobei der ursprüngliche Charakter des Gebäudes als wertvolles Gut betrachtet und erhalten wurde.
Bei der Sanierung von „La Nave“ in Madrid durch das Büro Nomos stand die Verschmelzung von Arbeits- und Wohnleben im Vordergrund. Das Ergebnis ist ein durchgängiger, fließender Raum, der mit lokalen Materialien und handwerklichen Baumethoden gestaltet wurde und eine nahtlose Nutzung ermöglicht.
Das Projekt Rec House in Igualada von Guallart Architects ist eingebettet in den Wandel eines gesamten Stadtviertels mit industrieller Tradition. Die Renovierung zweier Gebäude, die einst eine Textilindustrie und ein Wohnhaus beherbergten, unterstützt die Entwicklung des Viertels hin zu einem kreativen Zentrum für Künstler, Kultur und Gastronomie.
Diese Projekte machen deutlich, dass die Konversion industrieller Bauten mehr ist als eine bloße Zweckentfremdung. Sie ist eine nachhaltige Strategie der Stadtentwicklung, die historische Substanz bewahrt, identitätsstiftende Architektur erhält und durch ihre Neuinterpretation lebendige, moderne Wohnformen schafft.