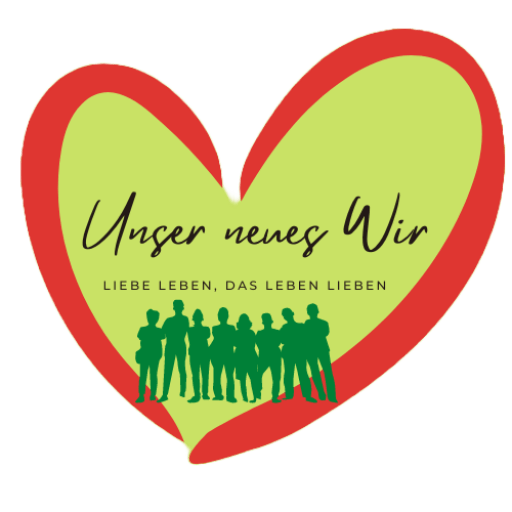Die stille Hierarchie der Schulfächer und der schwindende Raum für Kreativität
Es ist ein weltweit zu beobachtendes Phänomen, dass in den Lehrplänen der Schulen bestimmte Fächergruppen eine deutliche Priorität genießen. Den naturwissenschaftlichen Disziplinen, der Mathematik und den Sprachen wird gemeinhin ein höherer Stellenwert beigemessen als den künstlerischen Fächern wie Musik, Kunst oder auch dem Sport. Diese Gewichtung ist kein Zufall, sondern das Resultat einer historisch gewachsenen Struktur, die bis in die Gegenwart nachwirkt. Der Maler Pablo Picasso brachte einmal die Beobachtung zum Ausdruck, dass jedes Kind als Künstler zur Welt kommt. Die eigentliche Herausforderung liege jedoch darin, dieses künstlerische Potenzial zu bewahren, während das Kind heranwächst. Diese Perspektive legt die Vermutung nahe, dass Kreativität dem Menschen nicht erst im Laufe der Bildung zuwächst, sondern dass sie ihm angeboren ist und im schlimmsten Fall durch den Bildungsprozess verkümmert.
Die historischen Wurzeln eines industriegeprägten Systems
Um die Ursachen für diese Entwicklung zu verstehen, muss man einen Blick in die Geschichte des öffentlichen Bildungswesens werfen. Vor dem 19. Jahrhundert existierten flächendeckende staatliche Schulsysteme, wie wir sie heute kennen, nicht. Sie wurden maßgeblich im Zuge der Industrialisierung etabliert, um den wirtschaftlichen Bedürfnissen der damaligen Zeit gerecht zu werden. Die aufstrebenden Industrienationen benötigten eine gut organisierte und standardisierte Ausbildung ihrer Bevölkerung, um die Arbeitskräfte für die Fabriken und Verwaltungsapparate bereitzustellen. Infolgedessen formte sich eine Fächerhierarchie, die sich an unmittelbaren wirtschaftlichen Verwertbarkeitskriterien orientierte. Fächer, die direkt für die industrielle Produktion und administrative Tätigkeiten als nützlich erachtet wurden, stiegen an die Spitze des schulischen Curriculums.
Dieses Denken ist bis heute tief in unserer Bildungsmentalität verankert. Viele Schülerinnen und Schüler erhielten im Laufe ihrer Schulzeit den gut gemeinten, aber in seiner Grundaussage folgenschweren Rat, sich lieber von musischen oder künstlerischen Neigungen abzuwenden, da sich mit diesen kein seriöser Beruf erlernen ließe. Die Warnung „Mach‘ keine Musik, du wirst kein Musiker werden“ ist ein archetypisches Beispiel für diese Haltung. Sie suggeriert, dass der einzige Zweck einer Beschäftigung mit Kunst in der professionellen Ausübung bestehe und ihr ansonsten kein intrinsischer Wert zukomme. Diese Sichtweise blendet den enormen Beitrag aus, den kreative Bildung zur Persönlichkeitsentfaltung, zum Problemlösungsdenken und zur emotionalen Intelligenz leistet.
Die Dominanz des akademischen Intelligenzbegriffs
Ein weiteres fundamentales Element dieses Systems ist die übermäßige Betonung akademischer Fähigkeiten. Diese spezifische Form der Intelligenz, die vor allem auf logisch-mathematischem und sprachlichem Denken basiert, wurde im Laufe der Zeit synonym mit Intelligenz an sich gesetzt. Diese Verengung des Begriffs ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass die Universitäten als höchste Instanzen der Bildung das System über lange Zeit in ihrem Sinne geprägt haben. Wenn man das globale öffentliche Bildungssystem betrachtet, so lässt es sich als ein langwieriger Prozess beschreiben, dessen ultimatives Ziel im Bestehen der Zulassungsprüfungen für die Universität gipfelt.
Die Konsequenz dieser Ausrichtung ist, dass viele Menschen mit außergewöhnlichen Talenten in nicht-akademischen Bereichen zu der Überzeugung gelangen, sie seien nicht besonders intelligent oder begabt. Wenn die individuellen Stärken eines Schülers im Bereich der bildenden Kunst, der Musik oder des handwerklichen Geschicks liegen, diese Fähigkeiten im schulischen Kontext aber kaum gewürdigt oder gar stigmatisiert werden, führt dies unweigerlich zu einem Verlust an Selbstvertrauen und einer Vernachlässigung dieser Potenziale. In einer Zeit rapiden globalen Wandels, in der innovative und kreative Lösungen für komplexe Probleme gefragt sind wie nie zuvor, erscheint es jedoch zunehmend fragwürdig, ob wir es uns leisten können, weiterhin einen so großen Teil des menschlichen Begabungsspektrums zu vernachlässigen. Die Frage ist nicht, ob das System die Kreativität aktiv tötet, sondern ob es ihr den notwendigen Raum zum Leben und Gedeihen bietet.