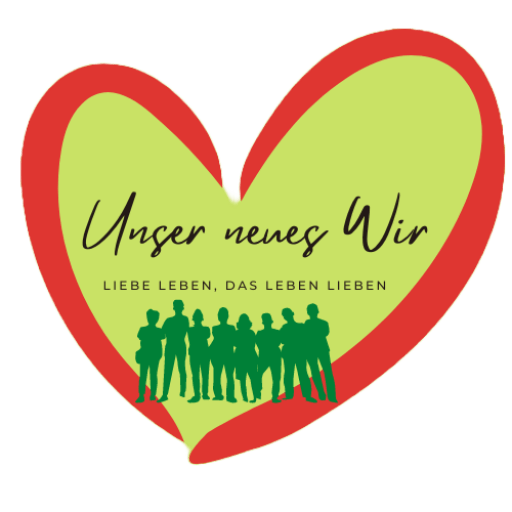Süßwasser-Pilze als natürliche Helfer gegen Kunststoffmüll
Mikropilze zeigen bemerkenswerte Fähigkeiten beim Abbau von Plastik
Die zunehmende Vermüllung unserer Umwelt mit Kunststoffen stellt eine ernsthafte Bedrohung für Ökosysteme und menschliche Gesundheit dar. Doch die Natur könnte bereits eine Lösung parat haben: Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) und der Universität Potsdam haben entdeckt, dass bestimmte Süßwasserpilze in der Lage sind, hartnäckige Kunststoffe wie Polyurethan, Polyethylen und sogar Reifengummi effizient zu zersetzen. Besonders bemerkenswert ist, dass diese Pilze dies ohne jegliche Vorbehandlung der Kunststoffe schaffen – ein Durchbruch, der in der Fachzeitschrift Science of the Total Environment veröffentlicht wurde.
Das Problem mit langlebigen Kunststoffen
Kunststoffpolymere können Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte in der Umwelt überdauern, da sie von natürlichen Mikroorganismen nur äußerst langsam abgebaut werden. Während die Welt nach praktikablen Lösungen für dieses drängende Umweltproblem sucht, rückt die biologische Sanierung – auch Bioremediation genannt – immer stärker in den Fokus. In diesem Zusammenhang untersuchte das deutsch-polnische Forschungsteam 18 verschiedene Pilzstämme aus Süßgewässern auf ihre Fähigkeit, drei der häufigsten Kunststoffarten zu zersetzen.
Die Ergebnisse waren vielversprechend: Bestimmte Stämme der Gattungen Fusarium, Penicillium, Botryotinia und Trichoderma zeigten eine besonders hohe Aktivität beim Abbau der Kunststoffe.
Warum Pilze ideale Plastik-Zersetzer sind
Doch was macht Pilze zu so effektiven Recyclern von Kunststoffen? Professor Hans-Peter Grossart, Leiter der Studie am IGB, erklärt: „Pilze produzieren Enzyme, die komplexe chemische Verbindungen wie Kunststoffe aufspalten können. Zudem sind sie durch ihr invasives Wachstum und ihre Fähigkeit, Biofilme zu bilden, perfekt an die sogenannte ‚Plastiksphäre‘ angepasst.“
Mithilfe von Rasterelektronenmikroskopie beobachteten die Forscher, dass sich die Zellwände einiger Pilze verformen, sobald sie Kunststoffe besiedeln. „Diese strukturellen Anpassungen ermöglichen es den Pilzen, sogar wasserabweisende Materialien wie Polyurethan zu kolonisieren“, erläutert Sabreen Samuel Ibrahim Dawoud, Doktorandin am IGB und Hauptautorin der Studie.
Ein cleverer Kreislauf: Pilze erschließen sich ihre Nahrung selbst
Durch spektroskopische Analysen und Messungen der Stoffwechselaktivität fanden die Wissenschaftler heraus, dass die Pilze die Kunststoffe zunächst enzymatisch angreifen und dabei Zwischenprodukte erzeugen, die ihnen als Kohlenstoff- und Energiequelle dienen. „Die Pilze bauen die Polymere schrittweise ab und erschließen sich so kontinuierlich neue Nahrungsquellen“, sagt Dawoud.
Keine Vorbehandlung nötig – ein entscheidender Vorteil
Ein bedeutender Fortschritt der Studie ist der Nachweis, dass die Pilze Kunststoffe auch ohne vorherige Behandlung mit UV-Licht, Ozon oder chemischen Verfahren abbauen können. Bisher gingen viele Forschende davon aus, dass solche Maßnahmen notwendig seien, um die Polymere für mikrobielle Angriffe zugänglich zu machen. „Unsere Ergebnisse zeigen, dass Pilze auch ohne diese aufwändigen Schritte aktiv werden“, betont Grossart.
Die besten „Plastikfresser“ unter den Pilzen
Unter den untersuchten Pilzstämmen erwiesen sich insbesondere Fusarium, Penicillium, Botryotinia und Trichoderma als effiziente Kunststoff-Zersetzer. Interessanterweise sind einige dieser Pilze in anderen Kontexten weniger willkommen: Fusarium-Arten etwa sind als Schädlinge in der Landwirtschaft gefürchtet, während Botryotinia Pflanzenkrankheiten verursachen kann. Trichoderma-Pilze sind dagegen wichtige Akteure bei der Zersetzung organischen Materials in Böden. Die Gattung Penicillium ist wiederum bekannt für ihre Rolle in der Medizin (Penicillin) und Lebensmittelherstellung (z. B. Schimmelkäse).
Polyurethan – der am leichtesten abbaubare Kunststoff
Die Studie brachte zudem wichtige Erkenntnisse darüber, welche Kunststoffarten sich besonders leicht zersetzen lassen. Von allen getesteten Materialien erwies sich Polyurethan (PU) als am besten abbaubar. „Diese Erkenntnis ist entscheidend für die Entwicklung großtechnischer Recyclingverfahren“, sagt Grossart. PU wird in zahlreichen Produkten eingesetzt – von Schaumstoffen über Sportbekleidung bis hin zu medizinischen Geräten – und ist besonders widerstandsfähig, was seinen Abbau in der Natur erschwert.
Methodik: Von der Probenahme zur Datenanalyse
Für die Studie entnahmen die Forscher Pilzproben aus den nordostdeutschen Seen Stechlin und Mirow. Die identifizierten Stämme wurden auf ihre Fähigkeit getestet, verschiedene Kunststoffe abzubauen, darunter Polyethylen (PE), Polyurethan (PU) und Reifenkautschuk. Die Versuche fanden sowohl auf festen Nährmedien als auch in Flüssigkulturen statt.
Mittels modernster Analysemethoden wie Rasterelektronenmikroskopie und Infrarotspektroskopie untersuchte das Team die strukturellen Veränderungen der Pilze und Kunststoffe. Die Auswertung der Daten erfolgte mit statistischen Verfahren, um die Abbauleistung der verschiedenen Pilzstämme zu vergleichen.
Ausblick: Pilze als Teil der Lösung
Die Ergebnisse der Studie eröffnen neue Perspektiven für die biologische Sanierung von Kunststoffabfällen. Während noch weitere Forschung nötig ist, um die Prozesse zu optimieren, zeigen die Süßwasserpilze bereits jetzt ihr Potenzial als natürliche Helfer im Kampf gegen die Plastikflut. „Die gezielte Nutzung solcher Pilze könnte künftig eine nachhaltige Ergänzung zu herkömmlichen Recyclingmethoden darstellen“, resümiert Grossart.
Angesichts der weltweit wachsenden Kunststoffberge könnte die Natur damit eine unerwartete, aber höchst willkommene Lösung bereithalten.
Quelle: sciencedirect.com