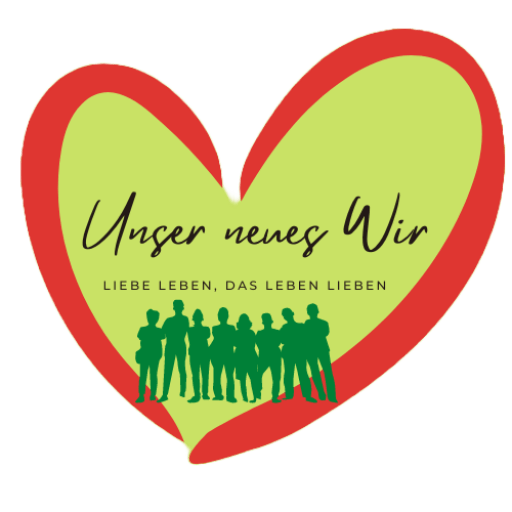Die verborgenen Kosten der Wegwerfmode: Eine Bestandsaufnahme
Die Modeindustrie hat sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend gewandelt. Anstelle von saisonalen Kollektionen bestimmen nun wöchentlich wechselnde Angebote das Bild in den Geschäften und Online-Shops. Dieser stetige Fluss neuer Kleidungsstücke zu Niedrigpreisen hat nicht nur unser Konsumverhalten verändert, sondern auch erhebliche Konsequenzen für die Umwelt und das Wohl der Tiere. Die Herstellung von Textilien hinterlässt tiefe Spuren in Ökosystemen und trägt zur Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden bei.
Die Belastung durch Textilproduktion
Bei der Herstellung von Kleidung kommen tausende verschiedene Chemikalien zum Einsatz, die häufig ungefiltert in die Umwelt gelangen. Besonders betroffen sind Flüsse und Gewässer in Produktionsländern, wo Färbe- und Veredelungsprozesse das Wasser mit Schwermetallen, Farbstoffen und anderen giftigen Substanzen kontaminieren. Diese Schadstoffe reichern sich in Sedimenten an und gelangen in die Nahrungskette. Die Weltbank schätzt, dass etwa 20 Prozent der industriellen Wasserverschmutzung auf die Textilfärbung und -behandlung zurückzuführen ist. Die chemische Behandlung von Stoffen hat nicht nur lokale Auswirkungen, sondern betrifft durch den globalen Wasserkreislauf letztlich das gesamte Ökosystem der Erde.
Das Leid hinter tierischen Materialien
Die Produktion von Wolle und Leder ist mit erheblichem Tierleid verbunden, das oft vor den Augen der Verbraucher verborgen bleibt. In der Wollindustrie werden Schafe unter Bedingungen gehalten, die nicht ihren natürlichen Bedürfnissen entsprechen. Bei der Schur kommt es häufig zu Verletzungen, die ohne angemessene Behandlung bleiben. Noch gravierender sind die Zustände in der Lederindustrie. Die Tiere, deren Häute später zu Leder verarbeitet werden, stammen häufig aus Massentierhaltungen mit unzureichenden Haltungsbedingungen. Die Gerbung des Leders erfolgt unter Einsatz von Chromsalzen und anderen Chemikalien, die nicht nur gesundheitsschädlich für die Arbeiter sind, sondern auch die Umwelt belasten.
Chemische Behandlung und ihre Folgen
Die chemische Behandlung von Textilien beginnt lange bevor ein Kleidungsstück in den Verkauf gelangt. Bereits bei der Anbaumode von Naturfasern wie Baumwolle kommen Pestizide und Insektizide in großen Mengen zum Einsatz. Synthetische Fasern auf Erdölbasis erfordern ebenfalls chemische Prozesse bei ihrer Herstellung. Die Ausrüstung von Textilien mit wasser-, schmutz- oder knitterabweisenden Eigenschaften basiert auf per- und polyfluorierten Chemikalien, die als langlebige Umweltstoffe gelten und sich in Organismen anreichern können. Auch nach dem Kauf eines Kleidungsstücks setzt sich der Kreislauf der Chemikalien fort, da bei jedem Waschgang Mikrofasern und chemische Rückstände ins Abwasser gelangen.
Die kurze Lebensdauer von Billigmode
Die schnelle Rotation der Kollektionen und die niedrigen Preise haben dazu geführt, dass Kleidung immer kürzer getragen wird. Viele Kleidungsstücke überstehen nur wenige Waschgänge, bevor sie ausgetauscht werden. Dieser Überkonsum führt zu riesigen Abfallbergen, die deponiert oder verbrannt werden müssen. Synthetische Fasern wie Polyester zersetzen sich nur sehr langsam und setzen dabei Mikroplastik frei. Selbst natürliche Fasern verrotten auf Deponien nur unter Sauerstoffabschluss, wobei Methan entsteht, ein potentes Treibhausgas. Die Recyclingquoten für Textilien bleiben niedrig, da die Mischgewebe und chemischen Behandlungen eine Wiederverwertung erschweren.
Wege zu einem nachhaltigeren Umgang mit Kleidung
Das Bewusstsein für die Probleme der Wegwerfmode wächst allmählich. Immer mehr Verbraucher fragen nach der Herkunft ihrer Kleidung und den Bedingungen, unter denen sie produziert wurde. Zertifizierungen für ökologische und faire Produktion gewinnen an Bedeutung. Einige Hersteller setzen auf geschlossene Kreisläufe, in denen Kleidung am Ende ihrer Lebensdauer recycelt wird. Der wachsende Markt für Second-Hand-Mode zeigt, dass sich auch wirtschaftliche Alternativen zum Neukauf etablieren können. Letztlich geht es darum, Kleidung wieder als wertvolles Gut zu betrachten, das sorgfältig ausgewählt, lange getragen und repariert werden sollte, anstatt es als Wegwerfartikel zu behandeln.